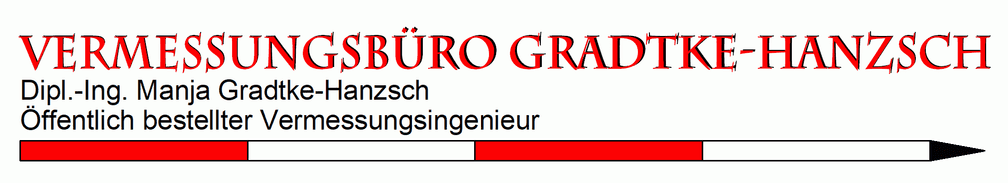Grenzzeichen = Abmarkungen
Das Setzen eines Grenzzeichens bezeichnet die Handlung des Abmarkens oder Vermarkens.
Grenzzeichen aus früherer Zeit
Feldstein mit/ohne Kreuz
Der Beginn des heutigen Liegenschaftskatasters liegt im Anfang des 19. Jahrhunderts, in der unbehauene oder behauene Natursteine aus der Region als Grenzmarkierungen verwendet wurden. Diese unbehauenen "Feldsteine" fallen aufgrund ihrer Form, Größe und Standfestigkeit in der Örtlichkeit auf. Es ist nicht selten, dass die Feldsteine sogar ein Grenzkreuz innehaben.
Naturstein
Ein besonderer behauender Naturstein ist auch ein Grenzstein, auf dem der eigentliche Grenzverlauf mittels einer eingemeißelten Kerbe (Weisung) dargestellt wird. Bei Eck- bzw. Knickpunkten sind dann abgewinkelte Linien auf dem Stein in T- oder Y-Form zu erkennen, wonach man den Grenzverlauf in der Örtlichkeit ablesen kann.
Meißelzeichen/ -kreuze
Auch unsere Berufskollegen aus früherer Zeit hatten Probleme, an Hindernissen wie Felskanten, Mauern oder Zaunsecken ein Grenzzeichen zu setzen. In der einst geltenden Vermessungsvorschrift war es ihnen erlaubt, Meißelzeichen bzw. Meißelkreuze anzubringen. Diese Meißelkreuze, auch "Flügelkreuze" genannt, fallen durch ihre markanten, teils dreieckig geformten Flügel auf. Leider sind sie der Verwitterung ausgesetzt und nur mit einem "geübten Blick" zu erkennen.
Sandstein
Früher hat man nicht nur Grenzsteine aus Feldsteinmaterial verwendet, sondern machte sich auch Sandsteine zunutze. Dieser ließ sich relativ einfach behauen und konnte auch in stattlicher Größe gefertigt und mit einem Kreuz versehen werden. Die Abmarkung der Grenze mittels eines Sandsteines fand bei uns in Sachsen zum Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhundert statt.
Betonstein
Der Sandstein wurde ab Mitte des 20. Jahrhunderts durch den Betonstein mit Kreuz abgelöst. Der Betonstein war ein zulässiges Abmarkungsmaterial in der Zeit der DDR.
Untervermarkungen
Um die Eindeutigkeit von z. B. unbehauenen Grenzsteinen oder auch bei Verlust des Grenzsteines zu erhalten und zu bezeugen, hat man damals sogenannte "Untervermarkungen" unter dem Grenzstein eingebracht. Diese sind unverwesliche Bestandteile, wie z. B. Ton- oder Ziegelscherben, Porzellan, Glasscherben oder auch ganze Flaschen (umgedreht, mit dem Boden nach oben). Besondere Untervermarkungen befinden sich beispielsweise an der ehemaligen preußisch-sächsischen Staatsgrenze. Dort hat man weiße Porzellanscheiben aus Meißen vergraben. Sie ähneln einem Puck, haben einen Durchmesser von ca.5 cm und eine Höhe von 1,5 cm.
Grenzzeichen aus heutiger Zeit
Granitstein
Der Granitgrenzstein mit Kreuz ist die üblichste Art, einen Grenzpunkt zu markieren. Er ist ca. 60 cm lang und hat einen Kopf von 10x10 cm. Er wird in der Regel bodengleich eingebracht, damit kein Bewirtschaftungshindernis (z. B. beim Rasenmähen) entsteht und er dennoch gut zu sehen ist.
Kunststoffmarken (MK)
Schlagmarken kommen nur dann zum Einsatz, wenn das Einbringen eines Granitgrenzsteines unmöglich ist. Das ist dann der Fall, wenn der Boden fest (z. B. Schotter) ist oder Hindernisse (z. B. Baumwurzeln) vorhanden sind. Die Schlagmarken bestehen aus einem Rohr oder T-Stahl-Schafft, der im oberen Bereich einen Polyester-Vierkantkopf (10x10 cm) mit der Aufschrift "Grenzpunkt" trägt. Im unteren Bereich befindet sich ein sogenannter Metallanker, der sich beim Einschlagen ins Erdreich weit öffnet und das Grenzzeichen fest im Boden einbringt.
Messingbolzen
Der Messingbolzen kommt bei versiegelten bzw. befestigten Oberflächen zum Einsatz. Für das Einbringen des Bolzens wird ein Loch in die Oberfläche gebohrt, ein Dübel eingebracht und schließlich der Bolzen eingeschlagen. Er besitzt eine Schaftlänge von 4 cm, einen Schaftdurchmesser von 8 mm und einen Kopfdurchmesser von 3 cm. Auf dem Kopf befindet sich das Wort "Grenzpunkt". Die Bolzen gibt es in horizontaler und vertikaler Ausführung.
Rohr mit Kappe
In der Örtlichkeit findet man auch die Vermarkung "Rohr mit Kappe" (Abkürzung: "RK") vor. Bei dieser Variante wird ein verzinktes Stahlrohr (10-20 cm lang) in den Boden eingeschlagen und die Kappe (6 cm Durchmesser mit der Aufschrift "Grenzpunkt") mithilfe eines Dübels befestigt. Diese Abmarkung könnte z. B. auf Kleinpflaster zum Tragen kommen, wenn sich der Grenzpunkt genau in der Fuge befindet.